Ich habe schon immer gerne gelesen. Mein liebster Leseort ist das Bett und gute Bücher kann ich nur schwer beiseite legen. Als Teenager habe ich regelmäßig meine Nachttischlampe wieder eingeschaltet, nachdem meine Eltern ins Bett gegangen sind – „nur noch ein Kapitel“ … Spoiler: Es blieb selten bei einem. Und ja, das rächte sich am nächsten Tag. Aber meistens war es das wert.
Seit die Kinder da sind, bin ich etwas vernünftiger geworden – Schlafdefizite kann ich auch nicht mehr einfach so wegstecken.
Als ich Edith Goulds Aufruf zur Blogparade las, wusste ich sofort: Da will ich mitmachen! Die Herausforderung bestand natürlich in der Einschränkung auf nur drei Bücher. Aber ich mag sowas. Und hier kommen sie nun: Drei Bücher, die meinen Blick auf die Welt verändert haben.
How to be good von Nick Hornby
Romane von Nick Hornby lese ich total gerne. Aber ich bin auf Umwegen auf diesen Autor gestoßen. Zunächst einmal kannte ich nur den Sänger Badly Drawn Boy, dessen erstes Album ein Jahr lang bei mir rauf und runter lief. Logisch, dass ich sein zweites Werk auch unbedingt haben wollte – das war noch zu den Zeiten, als man sich CDs kaufte. Und als ich dann mitbekam, dass es der Soundtrack zu einem Kinofilm war, war meine Neugier umso mehr geweckt. Den Film “About a Boy” habe ich mehrfach gesehen und er gehört zu den Filmen, die ich mir immer wieder ansehen kann (ich habe sogar noch die DVD).
Erst später, als ich als Au Pair ein paar Monate in London lebte, entdeckte ich Nick Hornbys Bücher in den Oxfam-Läden. Dort lagen sie in ihren knallbunten Penguin-Ausgaben. Ich verliebte mich in die Cover, investierte ein paar Pfund – und wurde nicht enttäuscht: feinster britischer Humor, London-Vibes und Geschichten mitten aus dem Leben.
“How to be good” war das erste Buch, das mich richtig aus der Bahn geworfen hat. Damals war ich 19 – und mein moralischer Kompass ziemlich starr. Schwarz und weiß. Richtig oder falsch. Punkt. Und dann las ich von Katie, Mutter, Ärztin, Ehefrau – die ihren Mann betrügt und trotzdem versucht, ein guter Mensch zu sein. Und plötzlich war da diese Frage: Was heißt eigentlich „gut“? Wer legt das fest? Kann man gleichzeitig liebevoll und fehlerhaft sein?
Gleichzeitig war meine Zeit in London voller Reibungspunkte – im besten Sinne. Sechs Monate mit einer anderen Familie zu leben hat mich ganz schön herausgefordert. Sie redeten viel Slang und ich verstand anfangs nur Bahnhof. Sie aßen andere Sachen (Hummus: erst war ich skeptisch, dann verliebt) und sie aßen die gleichen Sachen auf andere Weise (Auflauf mit einer Haube aus Kartoffelpüree – verstehe ich bis heute nicht). Sie hatten ein anderes Verständnis von Ordnung (gingen die Teebecher zu Neige, fand ich sie in den Zimmern der Mädchen – der Rekord lag bei 7 Bechern in einem Zimmer). Sie machten unglaublich viel Sport (was ich mit meinem Schulsport-Trauma gar nicht verstand). Sie nahmen sich auch noch Zeit für die musischen Dinge (Theater, Kunst, Musik – inklusive Gesangsunterricht und Theater-AG). Sie hatten einen Windhund und erzogen ihn nicht (Merlin im Park von der Leine zu lassen, war ein Glücksspiel – würde er wieder zukommen oder würde er wieder Eichhörnchen erbeuten?). Sie waren unglaublich tolerant und lebten eine andere Fehlerkultur (Ich dachte Steak sei ein anderes Wort für Kotelett und bereitete es so zu, wie ich es von Zuhause kannte – sie aßen es tapfer. Was medium rare ist, erklärten sie mir danach.). Und obwohl sie viele Dinge ganz anders angingen als meine Kernfamilie, fand ich mich in ihren zentralen Werten wieder: Freiheit und Verbundenheit.
In meiner London-Zeit lerne ich mehr und mehr die verschiedene Grautöne kennen und schätzen. Ich lernte, dass ein Widerspruch nicht immer aufgelöst werden muss. Dass verschiedene Perspektiven und Sichtweisen sein dürfen. Dass es ein sowohl-als-auch geben darf.
”How to be good” war das passende Buch zur passenden Zeit. Und es begleitet mich bis heute. Denn zugegeben, viele Dinge, um die es in diesem Buch geht, habe ich damals nur ansatzweise verstanden. Lese ich es heute, finde ich immer wieder etwas Neues darin.
Das Buch der vergessenen Artisten von Vera Buck
Dieses Buch habe ich im Babyjahr mit meinem zweiten Kind geschenkt bekommen. Das Cover – wunderschön. Der Klappentext – spannend. Und der Inhalt? Hat mich nachhaltig berührt. Es wanderte direkt auf meinen Nachttisch, obwohl der Schlaf in dieser Zeit eigentlich heilig war. Aber: Ich konnte nicht widerstehen.
Die Geschichte spielt Anfang des 20. Jahrhunderts. Der junge Mathis wächst in einem kleinen Dorf auf – als dreizehnter Sohn eines Bohnenbauern scheint sein Weg vorgezeichnet. Bis eines Tages der Jahrmarkt ins Dorf kommt und sein ganzes Weltbild durcheinanderwirbelt. Mathis bricht aus, schließt sich den Schaustellern an und wird Röntgenkünstler. Viele Jahre später lebt er mit seiner Partnerin Meta, einer Kraftfrau, in einer Wohnwagensiedlung am Rand von Berlin. In einer Zeit, in der Kunstschaffende verfolgt werden, Bühnen geschlossen sind – und ein Buch, das Mathis schreibt, alles verändern könnte.
Mich hat das Buch tief bewegt – nicht nur wegen der der atmosphärischen Dichte oder dem Spannungsbogen, sondern vor allem wegen der Fragen, die es aufwirft: Wie stark ist unsere familiäre Prägung? Und können wir uns davon lösen?
Besonders berührt hat mich die Beziehung zwischen Meta und ihrem Bruder. Wie eng sie miteinander verbunden sind – und wie viel Verantwortung Meta übernimmt, damit ihr Bruder seinen Platz im Leben finden kann. Ganz im Wortsinne, läuft sie dafür mehr als nur eine Extra Meile. Im Kontrast dazu steht die Kälte, mit der Mathis von seinen Brüdern behandelt wird. Zwei Welten, zwei Formen von Familie.
Beim Lesen habe ich viel über meine eigene Herkunftsfamilie nachgedacht. Darüber, welche Werte ich ganz selbstverständlich übernommen habe. Und wo ich vielleicht unbewusst Erwartungen erfülle, die gar nicht (mehr) zu mir passen. Ich habe angefangen, mich zu fragen: Welche Familienmuster möchte ich weitergeben – und welche bewusst durchbrechen?
Und dann war da noch diese große Frage: Was hätte ich getan, wenn ich in einer anderen Zeit, in einer anderen Familie, in anderen Umständen gelebt hätte? Dieses Buch war für mich wie ein Spiegel – und ein Fenster zugleich.
Spielen schafft Nähe – Nähe löst Konflikte von Aletha J. Solter
Wie ich auf dieses Buch aufmerksam wurde, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Wahrscheinlich war es – mal wieder – das Cover, kombiniert mit der Sehnsucht nach einem entspannteren Familienalltag. Die Fragen, die mich damals beschäftigten, waren ziemlich drängend: Wie kann ich mit meinen Kindern umgehen, ohne in alte Muster zu verfallen? Wie lösen wir Konflikte, ohne ständig in Machtkämpfe zu geraten?
„Spielen schafft Nähe“ war für mich ein echter Augenöffner. Aletha Solter beschreibt darin sogenannte Bindungsspiele – eine einfache, alltagstaugliche und gleichzeitig unglaublich wirksame Methode, um Stress abzubauen, Verbindung herzustellen und schwierige Situationen zu entschärfen. Kein kompliziertes Konzept, kein „pädagogisches Theater“, sondern: Spielen. Echt jetzt.
Das Buch hat mir gezeigt, dass Lachen genauso wichtig ist wie Tränen. Dass ein Spiel manchmal mehr bewirken kann als hundert Erklärungen. Und dass Kinder durch Spiel nicht nur Stress abbauen, sondern auch ihr Selbstbewusstsein stärken und ihre Beziehung zu uns vertiefen.
Besonders in stressigen Momenten – Hausaufgabenchaos, Streit unter Geschwistern, Zähneputz-Drama – haben uns die Bindungsspiele gerettet. Machtumkehrspiele, bei denen ich übertrieben dämlich dastehe („Hiiilfe! Mein Kind kann schneller rennen als ich!“) oder Nonsensspiele, in denen Kleidung plötzlich sprechen kann und anders angezogen werden will – all das bringt nicht nur die Kinder zum Lachen. Auch ich selbst merke, wie der Druck abfällt.
Das Buch hat mich nicht nur praktisch unterstützt, sondern auch emotional: Es hat mir Mut gemacht, nicht perfekt sein zu müssen. Es hat mir gezeigt, dass Nähe nicht entsteht, wenn alles glattläuft, sondern wenn wir zusammen durch schwierige Momente gehen – mit einem Augenzwinkern.
Und ganz ehrlich? Dieses Buch ist nicht nur für die Beziehung zu meinen Kindern wichtig geworden – sondern auch für die zu mir selbst.
Warum ich dir das alles erzähle?
Weil ich fest daran glaube, dass Bücher nicht nur unterhalten. Sie können uns verändern. Sie können uns neue Sichtweisen eröffnen, uns in Frage stellen, uns Mut machen. Diese drei Bücher haben genau das mit mir gemacht – jedes auf seine ganz eigene Art.
Vielleicht ist ja auch für dich eines dabei. Und wenn nicht – vielleicht hast du Lust, selbst über deine drei Bücher fürs Leben nachzudenken. Welche Geschichten haben dich geprägt?
Ich freu mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren mit mir teilst.
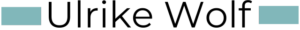






Schreibe einen Kommentar