Ich selbst bin Jahrgang 85 und habe somit kaum eigene Erinnerungen an meine Zeit in der DDR. Was lässt mich also denken, dass ich zu Sylvias Blogparade einen Beitrag beisteuern kann?
Dazu fallen mir spontan zwei Argumente ein. Zum einen, weil mich Menschen, die einen Großteil ihres Lebens in diesem Land verbracht haben, prägten. Zum anderen, weil ich später in meinem Leben Erfahrungen machte, die ich nur machte, weil ich an einem bestimmten Ort geboren und aufgewachsen bin.
Selbst gehört
Aus der DDR-Zeit sind mir vor allem Geschichten in Erinnerung geblieben. Geschichten, die immer wieder in unserer Familie erzählt werden. Darunter natürlich auch die ein oder andere Wende-Anekdote. Wie mein Onkel im Supermarkt der Person, die vor ihm bezahlte, hinterher rief: „Sie haben etwas vergessen!” und dann das Warentrennstäbchen hoch hielt. Wie mein älterer Cousin sagte: “Die haben hier behaarte Kartoffeln” und auf Kiwis zeigte.
Sehr viel bewusster habe ich die Zeit nach der DDR wahrgenommen. Einerseits die Verunsicherung darüber, was denn nun werden soll, wo Betriebe abgewickelt werden. Die Tristesse, die sich breit macht, wenn auch die Umschulung nicht zum erhofften Job verhilft und lediglich Aussicht auf die nächste ABM-Stelle besteht. Andererseits kenne ich auch die Energie und den Antrieb, den Menschen entwickeln, wenn sie merken, dass lang gehegte Träume wahr werden können. Abitur nachholen und ein Studium beginnen, etwas Land kaufen und ein Eigenheim bauen, auf Reisen in ferne Länder gehen.
Selbst erlebt
Die Erwachsenen aus meinem direkten Umfeld (Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel) gehörten zu den Menschen, die Rückschlägen zum Trotz den Kopf nicht in den Sand gesteckt haben. Die auf der Suche nach Lösungen immer weitergemacht haben. Mit ihren Taten und Worten schufen sie die Realität meiner Kindheit. Und das prägt mich bis heute.
Erst mit 16 Jahren habe ich selbst bewusst erlebt, wie anders der Blick von Menschen, die nicht “von hier” sind, auf die ehemalige DDR und ihre Bewohner sein kann. Ich verabredete mich mit jemandem, den ich nur aus dem Internet kannte. Es stellte sich heraus, dass er zum Studium nach Stralsund kam und außer dem Gelände der Fachhochschule noch nicht viel von der Stadt gesehen hatte. Also zeigte ich ihm meine Lieblingsorte in der Innenstadt. Aber wir kamen auf keinen gemeinsamen Nenner. Weder was Interessen noch Lebenseinstellung anging. Die Verabredung war für mich beendet, als er sagte:
„Das lohnt sich doch gar nicht alles zu restaurieren. In 20 Jahren lebt hier sowieso niemand mehr.“
Wütend stapfte ich nach Hause und meine Eltern durften sich allerhand anhören.
“Der feine Student wartet noch darauf, dass seine Eltern ihm seinen Bürostuhl bringen, denn an einem normalen Stuhl kann er nicht am Schreibtisch sitzen. […] Der weiß noch nicht mal wie man sich Spaghetti mit Tomatensauce kocht. Das Kochen übernimmt immer seine Mitbewohnerin. […] Der hat einen Döner gegessen und die ganze Zeit mit vollem Mund gesprochen.”
Es gibt einen Teil in mir, der selbst heute noch wütend wird, wenn ich an diese Begebenheit zurückdenke. Dieser Teil will ihm den Mittelfinger zeigen und rufen
“Schau her! Weil sich das alles nicht lohnt, rennen uns die Touristen die Bude ein. Wir sind UNESCO Weltkulturerbe! Sogar der Präsident der USA war hier!”
All das ist wahr.
Wahr ist auch, dass ich das nicht voller Überzeugung sagen kann, denn Stralsund ist schon lange nicht mehr “meine” Stadt. Ich bin in die Welt hinausgezogen, um anderswo mein Glück zu finden. Und habe dabei auch die Grenzen der ehemaligen DDR hinter mir gelassen. Gleichwohl bleibe ich beiden verbunden: der Stadt, die noch da ist (nur eben nicht in “meiner” Version) und dem Land, das nicht mehr da ist.
Was bis heute bleibt
#1: Arbeitende Mütter
Diese Verbindung zeigt sich zum Beispiel in meiner Einstellung zur Familie und Arbeit. Für mich war schon immer klar, dass ich Kinder haben und arbeiten werde. In meiner Welt kümmern sich beide Eltern um Hausarbeit, Kinder und das Familieneinkommen. Das hat zwei schöne Nebeneffekte: die Familie hat einen gemeinsamen Alltag und die Beziehung der Eltern basiert weiterhin auf Freiwilligkeit (weder ist sie finanziell abhängig von ihrem Mann, noch ist er emotional abhängig von seiner Frau).
Familienkonstellationen, in denen es eine klare Trennung der Bereiche gibt, kannte ich zunächst nur aus Erzählungen. Später lernte ich Menschen kennen, für die diese Trennung Realität war. Selbst Schuld, dachte ich mir, wenn ich Frauen traf, die nach sechs oder mehr Jahren Elternzeit Schwierigkeiten hatten, in ihrem Beruf wieder Fuß zu fassen. Mein Blick änderte sich, als ich selbst Mutter wurde.
2017: Wir bekommen keinen Krippenplatz für unser Kind.
Zum Glück fanden wir eine Tagesmutter, allerdings bot sie nur an vier Tagen pro Woche Betreuung an.
2019: Wir bekommen keinen Platz in den Ganztagsgruppen der Kitas.
2023: Die verlässliche (!) Grundschule unseres Kindes stellt die Betreuung zwischen 07:50 und 12:45 sicher. Benötigt eine Familie für ihr Kind darüber hinaus Betreuung, gibt es die Nachmittagsbetreuung. Für diese erhielten wir einen (!) statt der beantragten fünf Tage pro Woche.
Natürlich kann eine Mutter berufstätig sein, wenn es keine starken (institutionellen oder familiären) Strukturen für die Betreuung von Kindern gibt. Und bestimmt geht das auch in Vollzeit. Dann muss sie sich eben nur etwas mehr anstrengen. Oder mehr verdienen als ihr Mann, damit der dann zu Hause bleibt. Ironie ENDE.
Damit dieser Blogpost nun kein Plädoyer für die flächendeckende Errichtung von Kinderbetreuungsinfrastruktur und dessen Bedeutung für die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen wird, gehe ich lieber zum nächsten Punkt über.
#2: Entbehrung als Gewinn
Die Gegend, in der ich groß geworden bin, war auch schon vor 1945 strukturschwach. Blühende Landschaften sind keine Selbstverständlichkeit für mich. Ich kenne den Unterschied und das lässt mich viele Dinge wertschätzen, die andere Menschen nicht mal wahrnehmen. Das liegt allein daran, dass vielen anderen Menschen der Vergleich fehlt. Es ist immer der Vergleich nach oben, zum vermeintlich besseren, der uns Menschen unzufrieden macht. Und gleichzeitig kann der Vergleich nach unten (e.g.: zu einer Situation, aus der man sich herausgearbeitet hat) helfen zu erkennen, wie reich das eigene Leben ist.
Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich bei meinem ersten Besuch im Heimatort meines Mannes (ein Dorf im Münchner Speckgürtel) ungläubig einem Gespräch zweier Mütter lauschte. Die eine war dagegen, dass ihr Sohn einen Ausbildungsplatz in einem 40 Kilometer entfernten Ort annahm – da würde die tägliche Fahrt mit den Öffis zu lange dauern. Drei Gedanken schossen mir sofort durch den Kopf:
Er kann immerhin mit Bus und Bahn dorthin!
Wohnst du in Mecklenburg-Vorpommern in einem Ort ohne Bahnanschluss, hast du kaum die Chance, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Du kommst einfach nicht dorthin, wo du hin willst.
Davon wird dein Sohnemann nicht umkommen!
Zur weiterführenden Schule bin ich jeden Tag 40 Minuten mit dem Bus gefahren. Und nach der Schule ging es 40 Minuten zurück. Hatte ich sieben Stunden Schule, musste ich nach Schulschluss eine weitere Stunde warten, bis mein Bus kam. Der späte Bus fuhr die lange Runde (60 Minuten).
Sei doch froh, dass es hier was gibt!
Keiner meiner Freunde ist nach der Realschule in Mecklenburg-Vorpommern geblieben. Alle haben ihre Ausbildung in weit entfernten Städten begonnen, die meisten sind auch dort geblieben.
Nichts davon sprach ich damals in der Gegenwart dieser Mütter aus. Wahrscheinlich würde ich es heute anders machen und die ein oder andere Frage stellen. In der Hoffnung, meinem Gegenüber eine andere Perspektive zu eröffnen.
#3: Rückzug vs. Aufbruch
Da das politische System der DDR war wie es war, haben sich viele Menschen bewusst unpolitisch verhalten. Sie haben sich regelrecht in ihren eigenen kleinen Mikrokosmos zurückgezogen. Das galt auch für meine Eltern. Von Zuhause bekam ich Glaubenssätze wie “Am großen Ganzen können wir nichts ändern.” mit auf den Weg.
Als Coach weiß ich, dass das System Vorrang vor dem Individuum hat. Und dass Systeme träge sind, sich nicht so einfach ändern lassen. Aber möglich ist es eben doch. Gleichwohl bin ich eher eine gespannte und interessierte Zuschauerin, wenn sich etwas “in der Welt” tut. Proaktiv meinen Mikrokosmos erweitern und größere Systeme in Schwingung versetzen, lerne ich gerade noch. Mal sehen, wann ich damit fertig bin.
#4: Hilfe zur Selbsthilfe
Den ehemaligen DDR-Bürgern wird nachgesagt, dass sie sich gut selbst zu helfen wissen. Sie konnten nicht einfach in den Laden gehen und kaufen, was sie brauchten. Und so wurde vieles selbst repariert und Dinge wurden organisiert. Zweifelsohne hat mich das geprägt. Ich mag es, wenn ich beispielsweise Kleidung selbst repariere und sie nicht gleich wegwerfen muss. Ich war auch mächtig stolz auf mich, als ich gelernt habe, Wände zu verputzen. Aber vor dem Urlaub selbst das Auto durchchecken, damit man nicht liegen bleibt? Immer für den Notfall gerüstet sein?
Ist Hilfe zur Selbsthilfe eine typische ostdeutsche Eigenschaft? Wohl kaum. Ich kenne viele Menschen mit einer BRD-Vergangenheit, die klarkommen, ohne ständig Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Sollte man sich diese Eigenschaft bewahren? Unbedingt, es ist einfach super für die eigene Selbstwirksamkeit. Aber gilt es zu beweisen, dass man auch weiterhin gut ohne die Annehmlichkeiten der Marktwirtschaft klar kommt? Da habe ich Zweifel. Und bin sehr froh über meine ADAC Mitgliedschaft.
Verhaltensweisen kultivieren sich in Abhängigkeit zu den jeweiligen Lebensumständen. Und wenn sich die Umstände ändern, passen wir Menschen die jeweiligen Verhaltensweisen an. Das ist doch unsere eigentliche Kulturleistung. Dass wir lernen und uns so erfolgreich an neue Umstände anpassen können.
Fazit
Die letzten 35 Jahre haben definitiv bewiesen, dass wir das können. Nichts ist wie zuvor, weder im Osten noch im Westen.
Lernen und Anpassen geschieht nicht auf Knopfdruck. Das sind Prozesse, die Zeit brauchen und manchmal auch ins Stocken geraten. Und im Rahmen solcher Prozesse machen sich unterschiedliche Menschen nützlich. So kamen nach der Wende viele von drüben, um „Entwicklungshilfe“ zu leisten und den Ossis die Welt zu erklären. Auch dazu gibt es in meiner (und sicherlich jeder anderen ostdeutschen) Familie einen reichen Fundus an Geschichten. Die Wortneuschöpfung „Besserwessi“ gibt es nicht ohne Grund… Doch auch der Westen hat Entwicklungshilfe nötig, zum Beispiel beim Thema Gleichberechtigung.
Nur wer lässt sich gerne die Welt erklären? Ich jedenfalls nicht. Viel hilfreicher sind Begegnungen auf Augenhöhe. Dann ist Lernen ohne geschulmeistert zu werden möglich. Dann ist Anpassung ohne übermäßigen Druck möglich. Dann kann zusammenwachsen, was zusammen gehört und wir können von unseren unterschiedlichen Perspektiven profitieren.
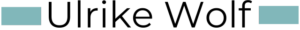






Schreibe einen Kommentar